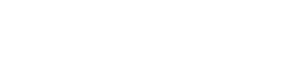
Entschuldigung
Die Seite kann leider momentan nicht aufgerufen werden.
In Kürze werden die gewünschten Seiten wieder erreichbar sein.
Ihre Nordkirche
webmaster@nordkirche.de